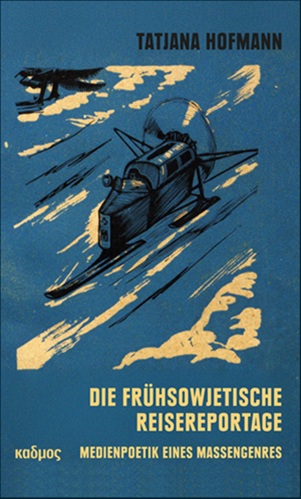









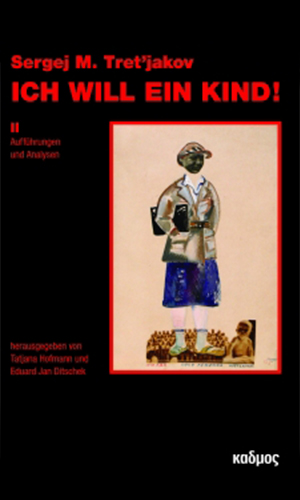

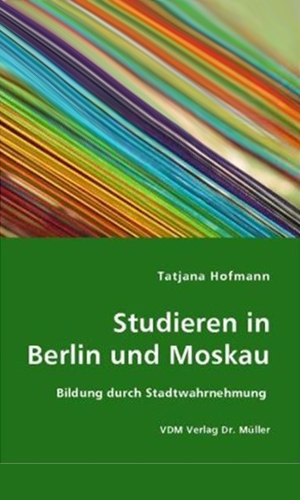
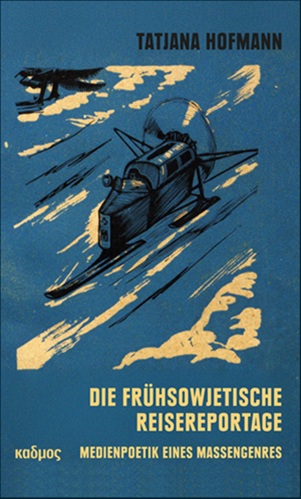
Diese Studie untersucht die sowjetische Reiseskizze bzw. -reportage der Zwischenkriegszeit, die bis heute ihre Aktualität bewahrt hat. Als ein politisches Mittel sowie ein transgressives und interkulturelles Genre hat sie die russischsprachige Literatur für neue Technologien geöffnet. Das Massenmedium bezieht neben Akteuren rund um LEF wie Sergej Tret’jakov, Boris Kušner und Viktor Šklovskij eine Reihe von Frauen ein, darunter Vera Inber, Mariėtta Šaginjan und Zinaida Richter. Die Studie nimmt Konfigurationen des reisenden Schreibens, Fotografierens und Filmens in den Blick. Close readings auf der Basis eines intertextuellen und -medialen Zugangs entwerfen eine Typologie, die die fluide Genrehaftigkeit als produktiven Zustand diskutiert: Dabei greifen Vergleichs-, Evidenz- und Abenteuernarrative ineinander. Für das Erfassen der Beziehung mobiler Praktiken und intertextueller Poetiken unterbreitet die Analyse das Konzept der Intertravelität.
Download Buch Link zum Verlag
Nach 1989 haben wir es in Osteuropa mit einem regelrechten autobiographischen Boom zu tun, der bis heute andauert. Autorinnen und Autoren öffneten die Schubladen, überarbeiteten längst geschriebene Manuskripte, rekonstruierten, erinnerten und experimentierten mit autobiographischem Material. Die entstandene Gegen-, Mikro- und Privatgeschichte zeigt, dass Geschichte nicht nur aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden kann, sondern dass sie je nach Erzählweise und ästhetischen Verfahren auch anders erscheint.
Das Buch versammelt literarische, philosophische und literaturwissenschaftliche Texte zum autobiographischen Schreiben nach 1989.
Mit Texten von: Čingis Ajtmatov, Nikita Alekseev, Przemysław Czapliński, Michał Głowiński, Tatjana Hofmann, Inga Iwasiów, Stefan Kisielewski, Igor Klech, Tadeusz Konwicki, Magdalena Marszałek, Stanisław Nowicki, Tatjana Petzer, German Ritz, Sylvia Sasse, Ulrich Schmid, Igor P. Smirnov, Franziska Thun-Hohenstein, Dubravka Ugrešić und Georg Witte.

Сергей Михайлович Третьяков (1892–1937) — поэт-футурист, драматург, теоретик, журналист, писатель-«фактовик» и неустанный путешественник по Советскому Союзу. Его одиссея началась еще в годы Гражданской войны, с поездки на Дальний Восток. По возвращении Третьяков работал в рабфаковских литобъединениях, в Пролеткульте и ЛЕФе. В 1924–1925 годах он прочел курс лекций по русской литературе в Пекинском университете, чуть позже начинает ездить по Кавказу, Европе, Сибири. Он уходит от поэзии и драматургии, переключившись на очерки, репортажи и гибридные жанры. Малоизвестный ныне, с середины 1920-х до середины 1930-х Третьяков был одним из самых издаваемых авторов, опубликовав почти шесть десятков книг (включая многочисленные переводы на иностранные языки). В публикуемом сборнике его путевая проза впервые представлена во всем разнообразии: от «путьфильмы» в Китай до «работы над ошибками» в одном из первых колхозов и агитационной критики западного капитализма. Всевозможные виды поездок пересекаются с разными способами передвижения — от поезда до аэросаней. Отчеты об архитектуре, искусстве, языке, политике и cоциальных связях в разных культурных сферах насыщенны и увлекательны. Само письмо автора также многообразно, порой статьи и заметки переходят в научную и приключенческую литературу. Именно в публицистике он развивает свои концепции длительного (фото-)наблюдения и оперативности писателя. Путевая проза Третьякова — попытка радикализации документалистики как инструмента обновления общества.
Link zum Verlag
Sergei Tretjakow zählt als Literaturtheoretiker zu den führenden Vertretern der linken Kunst-Avantgarde. Dass er daneben auch einer der aktivsten literarischen Kartographen der frühen Sowjetunion und seiner asiatischen wie europäischen Nachbarn war, ist kaum bekannt. Beginnend mit einem anderthalbjährigen Aufenthalt in Peking 1925/1926 publiziert Tretjakow über den Verlauf eines Jahrzehnts elf Sammelbände mit Reiseskizzen und mehr als hundert Reisereportagen, die zu den wichtigsten Dokumenten der sowjetischen Geopoetik zwischen Avantgarde und Frühstalinismus zählen. Als politische Texte betreiben sie eine Neuvermessung der Landkarte des Sozialismus. Als literarische Texte experimentieren sie mit poetischen Hybridformen, die nicht nur passiv gegebene Verhältnisse abbilden, sondern aktiv auf eine veränderte Welt hinarbeiten. Am Kreuzungspunkt dieser Stränge entsteht schreibend und reisend ein textueller Raum, der weit mehr ist als eine bloße Transkription der jungen Sowjetunion. Das Buch erscheint in der Magma-Reihe. Sergei Tretjakow (1892-1937) sowjetischer Schriftsteller und Vertreter des russischen Futurismus.
von Susanne Strätling (Herausgeberin), Tatjana Hofmann (Herausgeberin), Sergei Tretjakow (Autor)
Rezensionen:
Wolfgang Schlotts Rezension in Welt der Slawen (2022).
Download Rezension
Die gesamte Zeitschrift kann man unter folgendem Link downloaden:
Link zum Verlag/ DownloadRezensionen:
Hans Günther, Wiener Slawistischer Almanach 85 (2020), 465–471.
Download Rezension
Украину сотрясают внутренне и внешние конфликты - и не только в последнее время, на ней отразились вековые идеологические изломы и территориальные смещения. Предлагаемое исследование анализирует (мета-) литературные концепции Украины, основываясь на украинско- и русскоязычной прозе 1991-2011 гг. - первых десятилетий независимости страны. На фоне национального дискурса гетерогенные репрезентации различных регионов и городов Украины становятся местами проведения литературных эксплораций. В центре интереса стоит их участие во Writing Culture, как и этнографический модус в качестве основного приема презентации "Другого" - запись пережитых пространств. Оказывается, что примыкание вымышленной Украины к европейски коннотированному дискурсу реактивирует литературные характеристики, которые противоречат постмодернистскому мышлению: субъект, объявленный умершим, возвращается назад, "исправленная" и "истинная" история, как и познаваемая вне литературы топография, становятся предпосылкой. Нередко и читатели вовлекаются в процесс пространственно-культурной конструкции идентификации.
Download BuchRezensionen:
Tamara Hundorova: Novoe literaturnoe obozrenie 166 (2020): https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/166_nlo_6_2020/article/22972
Download Rezension
Nach 1991 findet eine verstärkte (Selbst-) Ethnologisierung der Ukraine in der Literatur statt. Dafür gestalten ukrainisch- und russischsprachige Prosatexte kulturelle und fiktionale Räume. Die Narrationen mit Fokus auf die West-, Ost-, Zentralukraine und die Krym sowie L’viv, Kyïv und Charkiv werden in dieser Studie zu Objekten einer «beobachtenden Lektüre» literarischer Explorationen. Die Ukraine ist nicht nur in letzter Zeit von innen- wie aussenpolitischen Konflikten zerrüttet, sondern seit Jahrhunderten von politischen Brüchen und territorialen Neuverschiebungen geprägt. Das zweitgrösste europäische Land ist zum Gegenstand national engagierter Konstruktionen und Dokumentationen geworden, die der Selbsterkundung und Positionierung dienen. Die Untersuchung analysiert dieses Phänomen anhand ukrainisch- und russischsprachiger Prosa aus der Zeit von 1991 bis 2011 – den ersten beiden Jahrzehnten der Unabhängigkeit der Ukraine.
Der nachholende Anschluss der fiktionalen Ukraine an europäisch konnotierte Diskurse verdeckt zeitgleich zu findende literarische Charakteristika, die dem postmodernen Denken widersprechen: Das totgesagte Subjekt kehrt zurück, die «korrigierte» und «wahre» Geschichte sowie ausserliterarisch erfahrbare Topografien werden vorausgesetzt.
Die Arbeit betrachtet, wie Prosatexte auf (meta)sprachlicher Ebene die Ukraine konzipieren – wie sie an der Writing Culture partizipieren und wie sie dafür das Konzept der Ethnografie, der Vertextlichung erlebter Räume, einsetzen. Sie geht auf diese Weise dem «ethnografischen» – Kultur beobachtenden und erschreibenden – Moment von Literatur nach, um eine theoretische und an komparatistischen Beispielanalysen ausgeführte Alternative zur postkolonialen Politisierung anzubieten. Vor der Folie des nationalen Diskurses stehen heterogene Repräsentationen verschiedener Regionen und Städte der Ukraine im Vordergrund.
Rezensionen:
Alois Woldan: Zeitschrift für Slavische Philologie 71.1 (2015), 228–234.
Download Rezension
Humor kennzeichnet über Jahrhunderte hinweg Texte verschiedener Provenienz und zeigt sich dabei in vielseitiger, verspielter bis hin zur politisierter, Ausprägung. Als narratives Element bestimmt er die Beziehung zwischen Erzählinstanz und Figuren und seit der Romantik die (selbst-)reflexive Erzählstimme, gar Weltsicht, die gattungsübergreifend wirkt.
Zur Anwendung kommt die ganze Palette rhetorischer Formen der Komik, die auf Unterbrechung, Umkehrung, Mechanisierung und Maskierung ausgerichtet sind. Situationskomik, Ironie, Witz, Satire kehren Verhältnisse um, schaffen neue Sinnzusammenhänge, brechen ins Phantastische aus, spielen utopische und dystopische Optionen durch. Humor kann die Kleinen gross, die Grossen klein erscheinen lassen, durch Verlachen sozial disziplinieren, subtil andeuten und zum Umdenken anregen, Gemeinschaften stiften und etablierte Subjekt-Objekt-Relationen ins Wanken bringen.
Der vorliegende Band versammelt Beiträge sowohl zu Aspekten einer historisch gewachsenen Verwendung von Humor im Hinblick auf seine gesellschaftskritische und transkulturelle Wirkungskraft als auch detaillierte Lektüren, die den Einsatz des Humors in seiner konkreten Ausgestaltung als künstlerisches Mittel untersuchen.
hrsg. von Marie Drath, Philippe P. Haensler, Tatjana Hofmann, Numa Vittoz

Книга о Сергее Третьякове, видном деятеле культуры первой трети ХХ века, расстрелянном в 1937 году в Москве. Журналист, поэт, драматург, футурист, друг Маяковского, Брехта и Эйзенштейна, редактор журнала "Новый ЛЕФ", сотрудник многих других журналов, в том числе "СССР на стройке" и "Интернациональная литература", состоял в Иностранной комиссии Союза писателей.
Download BuchRezensionen:
Anna Matveeva:godliteratury.ru
Download RezensionКовалев Н.И.: С. Третьяков. Хочу ребенка! Вопросы литературы 2021 (6), 262-265.
Download Rezension
Sergej M. Tret jakov (1892-1937) war eine zentrale Figur der russischen literarischen Avantgarde. Zusammen mit Eisenstein und Mejerchol'd engangierte er sich für ein neues Verständnis von Theater und Gesellschaft. Typisch dafür und für die vertrackte Rezeption des fast vergessenen Autors steht das Stück »Ich will ein Kind!«. Dessen zweite Variante hat zwar Bertolt Brecht bearbeitet, doch fand es erst ab 1980 seinen Weg auf die Bühne, und das in der BRD nicht in der Sowjetunion.
Das Stück wirft auch heute Fragen auf, die Mitte der 1920er Jahre für Provokation sorgten: Eine Frau neuen Typs sucht für ihre Schwangerschaft einen Erzeuger statt einen Lebenspartner. Kaum Mutter geworden, fährt sie weg. Als sie ihr Kind im Kinderheim besucht, trifft sie dort den Kindesvater wieder und ignoriert seinen Anspruch auf Miterziehung. Diesen provozierenden und gleichzeitig anregenden Plot garniert Tret jakov mit Anspielungen auf den sowjetischen Alltag der 1920er Jahre sowie auf eine Vielzahl von Themen und Hypothesen aus Literatur, Kunst und Wissenschaft.
Diese Edition präsentiert erstmals »Ich will ein Kind!« in seinen unterschiedlichen Stückvarianten und im nie realisierten Filmskript. Der zweite Band dokumentiert die Diskussionen und Inszenierungspläne zur Entstehungszeit des Stückes ebenso wie spätere Aufführungen. Analysen und Kontexte verdeutlichen den Facettenreichtum des unbequemen Stücks.
Von Eduard Jan Ditschek (Hg.), Tatjana Hofmann (Hg.)
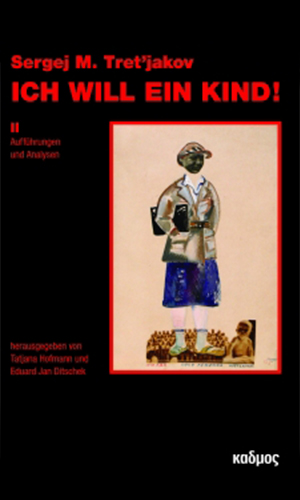
Von Eduard Jan Ditschek (Hg.), Tatjana Hofmann (Hg.)
Link zum VerlagRezensionen:
Hans Günther, Wiener Slawistischer Almanach 85 (2020), 465–471.
Download RezensionMarianne Streisand, Zeitschrift für Theaterpädagogik 78 (2021), 50–51.
Download RezensionWladislaw Hedeler: Zur deutschen Edition von Sergej M. Tret’jakovs Drama „Ich will ein Kind!“, Berliner Debatte Initial 31 (2020) 3, 128–130.
Download RezensionJan Knopf: „Die Anarchie der Liebe oder Ein dicker weisser Fleck in der Brecht-Landschaft. Zur zweibändigen Neuausgabe von Sergej Tretjakows Ich will ein Kind!“, Dreigroschenheft 4 (2019), 34–41.
Download RezensionErik Zielke: „Auch du, Arbeiterin“, Theater der Zeit 11 (2019), 73.
Download RezensionKlaus Völker: „Revolution des Lebens. Neue alte Stücke von Sergej Tretjakov“, Theater heute 12 (2019), 48.
Download Rezension
Für das Verständnis einer grundsätzlichen Mehrsprachigkeit literarischer Texte stellt Michail Bachtins Konzept der Redevielfalt bis heute einen prägenden Ansatzpunkt dar. Literatur, die Redevielfalt zum Ausdruck bringt, bewegt sichinnerhalb eines doppelten Bezugssystems. Sie nimmt die Mehrsprachigkeit des Aussen auf und reflektiert sie in ihrer eigenen Form. Literarische Mehrsprachigkeit bietet einen Ort der Inszenierung und Auslotung des Mehr-Sprachlichen, das konstitutiv an der Struktur der jeweiligen Texte mitwirkt. Zum einen betritt man die vielfältig ausgeprägten, historisch und sozial konnotierten ,Räume‘ unterschiedlicher Arten von Sprachbewusstsein und -praktiken. Gleichzeitig markiert die Mehrsprachigkeit aber immer auch einen Ort der radikalen Sprachautonomie von literarischen Texten selbst. Literarische Mehrsprachigkeit bedeutet somit auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das konkrete Zusammenwirken unterschiedlicher Merkmale einer ‚poetischen Funktion‘ der Sprache: Rhetorische Figuren, metrische Äquivalenzen, gattungsbedingte Sprachmuster u. v. m. lassen sich als Möglichkeiten begreifen, Redevielfalt in den einzelnen literarischen Texten poetisch umzusetzen.
Hg. von Marie Drath, Stefanie Heine, Tatjana Hofmann, Reto Zöller
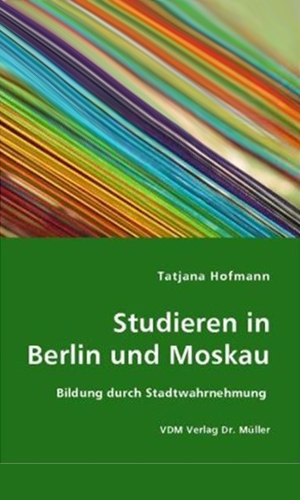
Auslandssemester gehören mittlerweile zur universitären Ausbildung dazu. Was jedoch bringen ein oder zwei Semester in einer fremden Stadt den Studierenden? Wie nehmen sie das jeweils Andere wahr und welche Strategien entwickeln sie vor Ort? Diese Fragen stehen im Vordergrund der Studie über Berliner und Moskauer Studierende, die im Rahmen von Universitätspartnerschaften ihre Studienstädte "gewechselt" haben. Dabei ist die Sicht der Akteure zentral, die in qualitativen Interviews und teilnehmender Beobachtung erhoben wurde. Abseits der seit Danckwortt üblich gewordenen Anpassungskurven, die die Assimilation an das Gastland messen sollen, zeigen die Studierenden individuelle Stadtcharakterisierungen auf. Die mentalen Stadtbilder stellen eine Art imaginäres Kapital dar, das sie benutzen, um in ihren Zukunftsvorstellungen die jeweilige Gaststadt einzubeziehen. So unterschiedlich Berlin und Moskau sind, so ähnlich sind dagegen die Wahrnehmungsmuster der Studierenden, womit die nationale Determiniertheit bei der "Anpassung" obsolet wird.
Link zum Verlag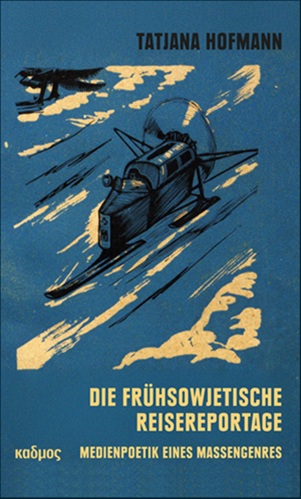









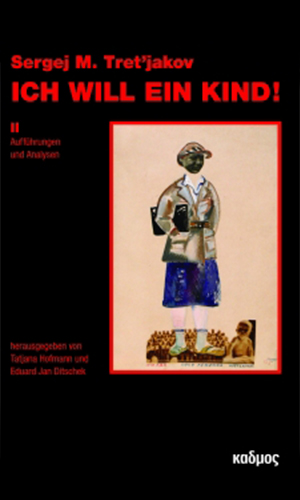

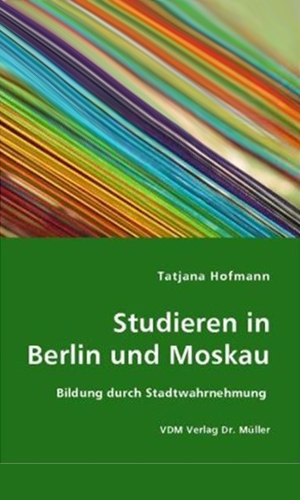
Dr. Tatjana Hofmann
Wissenschaftlerin, Autorin und ÜbersetzerinE-Mail: tatjana.hofmann@unisg.ch
Tatjana Hofmann 2025 ©
Alle Rechte vorbehalten.